Grundstücks-Prüfung
Sie sind Eigentümerin oder Eigentümer eines Grundstücks und denken, dass es für die Nutzung erneuerbarer Energien geeignet sein könnte?
Sie möchten als Kommune oder Stadtwerk gemeindeeigene Flurstücke für die Erzeugung von nachhaltigem Strom oder Wärme nutzen?
Sie vertreten ein Unternehmen, das sich dekarbonisieren möchte und dafür nach geeigneten Flächen in der unmittelbaren Umgebung Ihrer Standorte für die Direktversorgung mit erneuerbaren Energien?
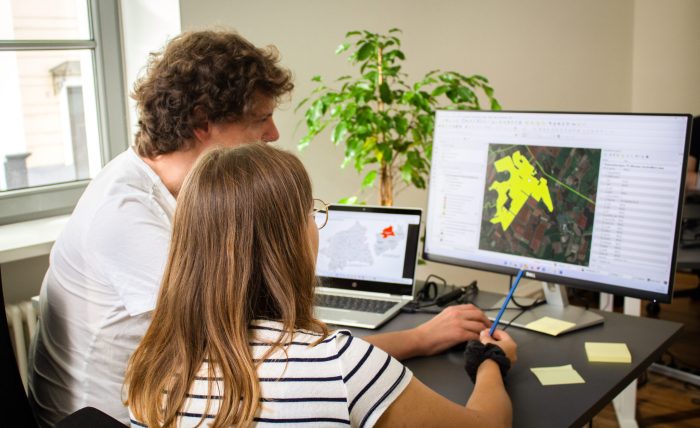
Geben Sie uns im untenstehenden Formularnur wenige Informationen zu den gewünschten Flächen und wir führen mithilfe unserer automatisierten GIS-Modelle eine umfassende Vorprüfung zu deren Eignung für die Erzeugung von erneuerbaren Energien durch.
Innerhalb weniger Tage melden wir uns mit unserer Einschätzung bei Ihnen, selbstverständlich kostenlos.
Wie geht es dann weiter?
Wenn sich Ihre Fläche für die Umsetzung eines Projektes eignet, könnte der Projektverlauf im Weiteren so aussehen:
- Nach Einigung über die Rahmenbedingungen kommt es zum Abschluss eines Flächennutzungsvertrages
- Wir übernehmen für Sie die Verhandlung mit politischen Gremien und Erwirkung eines Aufstellungs- und Satzungsbeschlusses
- Wir nehmen den Kontakt zu Projektierungsgesellschaften auf und suchen den für Sie passenden Partner für die Umsetzung des Projekts. Dabei verhandeln wir die bestmöglichen Vertragsbedingungen in Ihrem Sinne.
- Alternativ nutzen wir unser breites Netzwerk aus verschiedenen Partnern, um Ihnen bei der Realisierung eines eigenen Projektes zu helfen und dieses anschließend selbst zu betreiben
- Das Projekt wird an dieser Stelle an die Projektierungsgesellschaft übergeben
- Zum Schluss kann die bauliche Umsetzung beginnen!
